Caspar Schärer: Herr Fingerhuth, wie sieht aus Ihrer Sicht das Anforderungsprofil eines Kantonsarchitekten aus?
Carl Fingerhuth: Es ist ziemlich eindeutig: Der Kantonsarchitekt ist zuständig für die Planung und Erstellung der kantonalen Bauten. Sein Einflussbereich ist eng begrenzt; einen Auftrag für Baukultur gibt es nicht. Da die Ökonomie im Bauwesen derart dominant geworden ist und das Effizienzdenken aus dem Privatsektor zunehmend von der öffentlichen Verwaltung übernommen wird, werden heute eher Manager für diesen Posten gesucht – Personen, die in der gewünschten Zeit und zu den gewünschten Kosten Projekte abwicklen können.
Ludovica Molo: Das ist eine ernüchternde Diagnose der gegenwärtigen Lage. War die Situation eine andere, als Sie von 1978 bis 1992 Kantonsbaumeister in Basel waren?
Sehr viel hängt vom Verhältnis zur Politik ab. Ich hatte zu meiner Zeit in Basel das Glück, einen Regierungsrat zu haben, der mir viele Freiheiten liess. Er war Bauingenieur und hatte ein Verständnis für das Bauen.
Man darf aber nie vergessen, dass Basel als Stadtkanton ein Sonderfall ist. Die kantonale und die kommunale Ebene sind eins. Wenn die Verwaltung etwas für die Baukultur erreichen möchte, dann ist es auf der kommunalen Ebene. Die Diskussionen werden in den Gemeinden geführt, wo auch die Baubewilligungen erteilt werden. Das Problem der fehlenden Baukultur ist viel genereller und beschränkt sich nicht auf die Kantonsarchitekten.
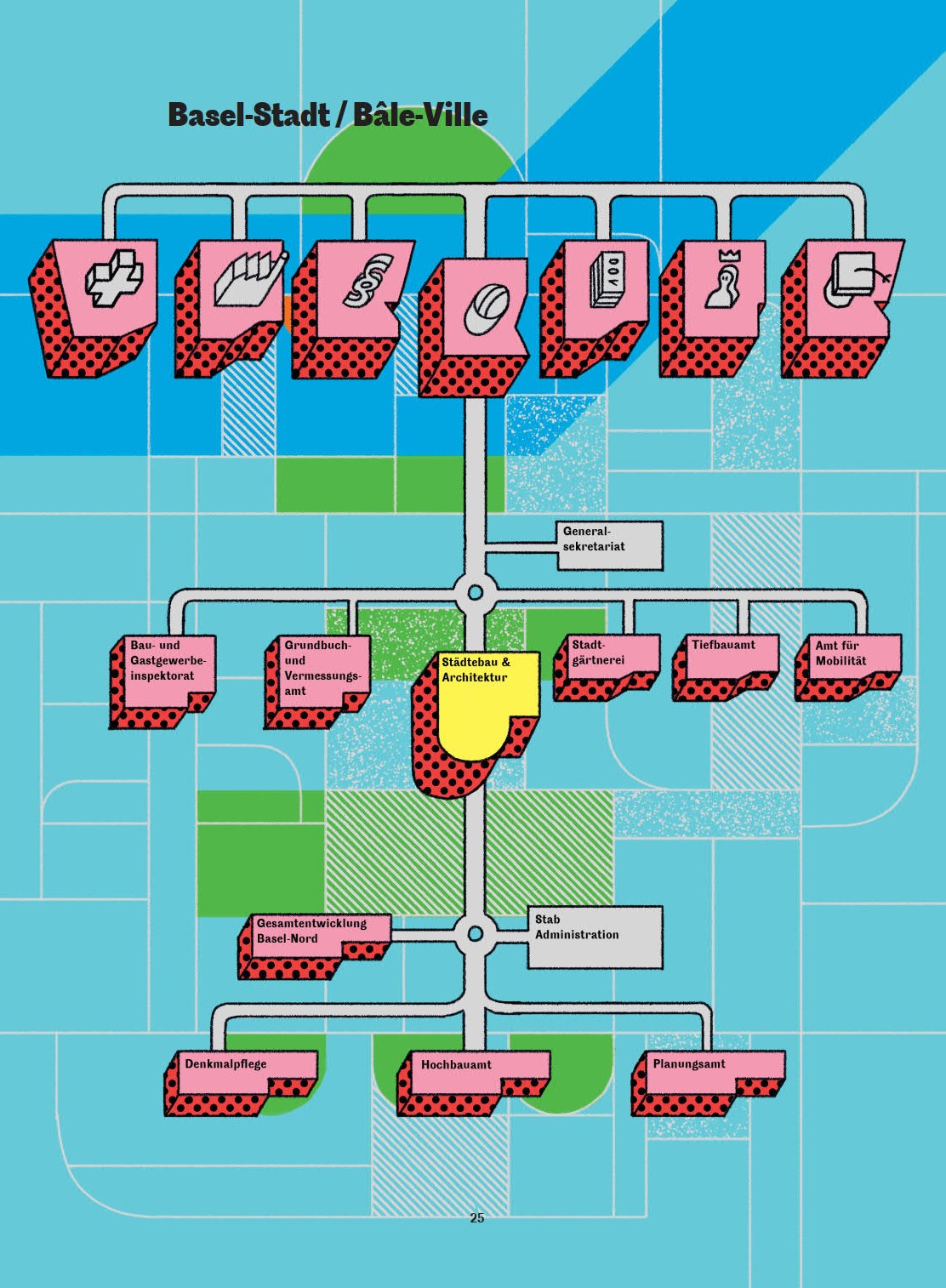
CS: Hatten Kantonsarchitekten damals mehr zu sagen als heute?
Nein, nicht unbedingt. Eine gute Fügung für mich war die historische Konstellation im Basel der späten 1970er Jahre. Es war eine Wendezeit: Die Moderne neigte sich dem Ende zu und es kamen die ersten alternativen Bewegungen auf, die von so seltsamen Dingen wie Wohnqualität sprachen. Damals teilten sich Suter+Suter und Burckhardt+Partner den Markt untereinander auf. Ich habe eingeführt, dass keine Aufträge mehr ohne Wettbewerb vergeben werden; das war das Ende des Duopols. Wir fingen mit Baulücken an und veranstalteten erste Wettbewerbe. Das war oft kantonales Land, das im Baurecht vergeben wurde. So hatten wir einen Hebel in der Hand. Ein anderer Hebel waren die Baulinien. So wollte etwa die Bankgesellschaft für ihren Neubau am Aeschenplatz die Baulinie versetzen; ich habe es ihr erst erlaubt, als sie sich verpflichtete, einen Wettbewerb durchzuführen – den dann bekanntlich Mario Botta gewann. Jemand muss sich halt um diese Dinge kümmern…
CS: Sie hatten also durchaus einen Auftrag für Baukultur…
…den ich mir selber gegeben hatte! Der Regierungsrat liess mich gewähren.
LM: Wie sind Sie eigentlich zu der Stelle gekommen? Haben Sie sich auf ein Inserat gemeldet?
Der BSA hat mich vorgeschlagen!
LM: Die Vermittlung der Baukultur muss nach Möglichkeit auch über die Medien geschehen. Wie war das während Ihrer Zeit in Basel?
Ich habe nach jedem Wettbewerbsentscheid eine öffentliche Orientierung und eine Ausstellung organisiert. Wir haben immer erklärt, warum wir das jeweilige Siegerprojekt ausgewählt hatten.
LM: Gab es seitens der Zivilgesellschaft ein Interesse an den städtebaulichen Themen?
CF: Ja, zumindest in Basel. Aber das ist ja auch klar in einem Stadtkanton. Es gab zum Teil heftige Auseinandersetzungen. So hat zum Beispiel der lokale Gratisanzeiger eine Umfrage durchgeführt und das «hässlichste Haus Basels» gesucht. Eine Mehrheit der Leserinnen und Leser bezeichnete Roger Dieners Neubau im St. Albantal als besonders hässlich. Daraufhin haben wir vor Ort eine öffentliche Diskussionsveranstaltung durchgeführt und uns erklärt.
LM: Sie hatten in Basel perfekte Bedingungen. Aber wie können heute Kantonsarchitekten in ländlichen Kantonen agieren – an Orten, an denen es keine offensichtliche Unterstützung für die Baukultur gibt, geschweige denn für den Städtebau.
CF: Ich bin der Meinung, dass die Bewegung immer vom Ort selber kommen muss, aus der Gesellschaft heraus. Es braucht einen breit abgestützten kulturellen Diskurs, und – ich wiederhole mich – die Fachverbände können massgeblich dazu beitragen.
Zug zum Beispiel: Zug wurde überrollt von den ökonomischen Kräften, dass es fast nicht mehr möglich ist, über andere Werte zu sprechen. Niemand hat Widerstand geleistet.
CS: Wenn der Spielraum der Kantonsarchitekten so klein ist, muss sich dann ein Verband wie der BSA nicht dafür einsetzen, dass sich das Stellenprofil ändert – hin zu mehr Freiheit und horizontaler Durchlässigkeit?
CF: Das mag sein, dass das etwas bewirkt. Aber der Impuls muss von der politischen Seite her kommen. Ich sehe das weniger als eine Frage der Richtlinien als eine tägliche Arbeit. Baukultur und Städtebau müssen jeden Tag verbreitet und verteidigt werden! Hochhausdiskussionen kann man nicht entlang von Richtlinien führen, sondern muss sie als kulturelle und städtebauliche Frage betrachten.
CS: Mit welchen Kompetenzen sollte denn so eine Figur ausgestattet sein?
Ich glaube, es ist weniger eine Frage der Kompetenz als der Autorität. Man kann Kompetenz nicht erzwingen. Stattdessen muss man Leute finden, die bereit sind, sich Freiheiten zu nehmen und Risiken einzugehen.
LM: Und welche Rolle könnten die Fachverbände einnehmen?
CF: Die Fachverbände müssen sich mehr wehren! Sie sind der wichtigste Player bei der Förderung der Baukultur, indem sie sich in der Öffentlichkeit dafür einsetzen. Dieses Engagement fehlt leider in hohem Mass und das ist ein gravierendes Problem – gerade wenn man die grossen Projekte in den Städten anschaut. Es fehlt in der Schweiz eine Kultur des Städtebaus: Niemand setzt sich für den Städtebau ein, auch die Architektinnen und Architekten nicht.

Carl Fingerhuth (1936-2021) war Architekt und Städtebauer; von 1978 bis 1992 war er Kantonsbaumeister in Basel-Stadt. Seit 1992 arbeitet Carl Fingerhuth als Hochschullehrer und beratender Experte; er ist Honorarprofessor an der Technischen Universität Darmstadt und Mitglied verschiedener Gremien und Kommissionen.