«Der Architekt: Ich bekomme einen Auftrag, dazu ein Grundstück, dessen Baufluchten meines Erachtens ein schlechter Witz sind, aber ein gesetzlich geschützter Witz. Was soll ich tun? Wenn ich kein Träumer bin, bleibt mir als Architekt nichts anderes übrig: ich entwerfe im Rahmen der Gegebenheiten, ich baue nach den Vorschriften der herrschenden Bauordnung, die bis zum Baubeginn nicht zu ändern, also hinzunehmen sind, gleichviel wie ich nun darüber denke. Wozu soll ich viel darüber denken! Ich muß ja bauen. Ich will ja bauen.»[1]
Die Diagnose von Max Frisch hat noch nach über einem halben Jahrhundert Gültigkeit: Architekten – und natürlich auch Architektinnen – schimpfen über die Gesetze, nehmen sie aber hin. Grundlegende Faktoren werden in den Regulierungen vorgegeben, so die Nutzung eines Gebäudes, seine Setzung und Volumetrie, ja selbst die Ausbildung einzelner Bauteile. Wesentliche Determinanten sind somit bereits vor der Entwurfsarbeit wortwörtlich vorgeschrieben. Architekten empfinden die Baugesetze zu Recht als «Baubeschränkungen», wie sie früher offiziell auch hiessen.[2] Sie suchen häufig nicht mehr nach einer architektonischen Lösung eines Problems, sondern nach einer Lösung der baurechtlichen Vorgaben.[3]
Max Frisch diagnostizierte aber noch etwas Weiteres, das leider ebenfalls nach wie vor zutrifft: Architekten nehmen ihren gesellschaftspolitischen Auftrag nur ungenügend wahr. Sie gaben zugunsten der Überbauung einzelner Parzellen die Bebauung des Landes aus den Händen. Sie haben sich aus dem politischen Diskurs und den Disziplinen des Städtebaus und der Raumplanung weitgehend verabschiedet und überliessen diese Kompetenzen Politikern, Juristen und Raumplanern. Anstatt sich aktiv in den Diskurs der Landesplanung einzubringen und mögliche Siedlungsbilder zu entwickeln, tun Architekten das, was sie am liebsten tun: bauen.
Architektur darf sich aber nicht auf die Errichtung schöner Häuser beschränken, sie ist vielmehr die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen. Und das drängendste Problem dürfte mittlerweile allen bekannt sein: die Zersiedelung des Landes. Die Schweiz krankt daran seit vielen Jahren. Eine Kruste der Versteinerung zieht sich über das Land. Fährt man heute durch die Schweiz, so fragt man sich mancherorts, wieso diese Bauten, die da verstreut in der Landschaft herumstehen, überhaupt erstellt werden durften. Haben wir denn keine Baugesetze? Hat die Schweiz nicht eine Raumplanung? Ist laut Bundesverfassung nicht eine «haushälterische Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes» vorgeschrieben?[4]
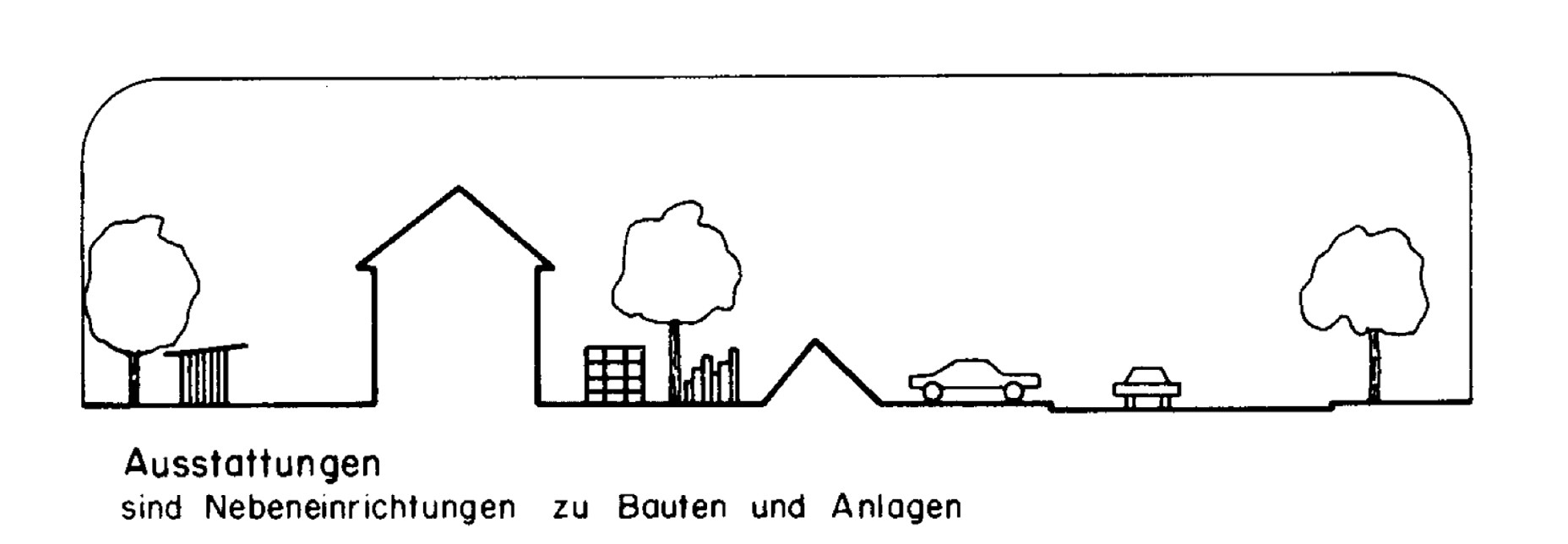
Studieren wir die Baugesetze genauer, gleichen sie dem Versuch, die Symptome mittels verschiedenster Medikamente zu lindern. Für sich genommen sind sie womöglich sinnvoll, in ihrer Summe führen sie aber zu Kontraindikationen, die die Krankheit nicht bekämpfen, sondern befeuern. Es offenbart sich zudem, dass die Gesetzgebung die qualitativ mangelhafte Siedlungstätigkeit nicht nur erlaubt, sondern teilweise forciert, ja sogar vorschreibt. Exemplarisch für die schweizweite Planungsmisere zeigt die erste Illustration der «Allgemeinen Bauverordnung» des Kantons Zürich ein Einfamilienhaus, das hinter einer Böschung auf der grünen Wiese steht, flankiert von einer Hecke und Autos.[5] Dass damit keine «haushälterische Nutzung des Bodens» erreicht werden kann, ist offensichtlich.
Diese Widersprüche verweisen auf das komplexe Thema der Raumplanung und Baugesetzgebung. Beide agieren im Kreuzfeuer verschiedener Disziplinen, föderalistischer Ebenen, politischer Instanzen und privater Akteure, die alle ihre Partikularinteressen wahrnehmen und meist gegenteilige Ziele verfolgen. Die Baugesetzgebung operiert zu dem immer in der Schnittmenge zwischen öffentlichem und privatem Recht, zwischen Anforderungen der Gemeinschaft und Wünschen des Einzelnen. Konflikte sind vorprogrammiert.
Es war jedoch die breite Öffentlichkeit, die in jüngeren Initiativen und Abstimmungen mit grosser Mehrheit ihr Unbehagen gegenüber der praktizierten Siedlungstätigkeit äusserte. Nach Jahrzehnten der Raumplanung stellt sie fest, dass die in der Bundesverfassung geforderten Ziele nicht erfüllt wurden. Sie fordert, dass in Zukunft nicht mehr auf der grünen Wiese gebaut, sondern nach innen verdichtet werden soll. Durch diese Neuausrichtung, die vom Bestand ausgeht und diesen weiterentwickeln möchte, sind Architektinnen und Architekten gefragter denn je.
Nicht zuletzt bedarf es ihrer Kompetenz hinsichtlich einer Neuauslegung des Baurechts. Baugesetze sollen nicht einfach hingenommen werden, sondern bedürfen selbst der Gestaltung. Wer, wenn nicht die Architekten, können auf Probleme der Baugesetzgebung hinweisen und innovative Lösungsansätze entwickeln? Denn Baugesetze sind veränderbar. Und, wie Juristen erklären: «Wenn die Ausrichtung der räumlichen Planung […] im Umbruch ist, dann betrifft dies notwendigerweise auch die rechtlichen Spielregeln.»[6]
Baugesetze sind per se nämlich keineswegs schlecht. Einige der schönsten städtebaulichen Ensembles, die die Schweiz zu bieten hat, sind gemeinschaftlichen Übereinkünften und strengen Reglementierungen zu verdanken. Doch waren diese Regeln eng mit einem konkreten städtebaulichen Entwurf und insbesondere mit einem wünschenswerten Bild des gemeinschaftlichen Zusammenlebens verbunden. An eine solche Planungskultur ist erneut anzuknüpfen. Es wäre vermessen zu behaupten, dass Architekten alle raumplanerischen Probleme lösen könnten. Ohne sie geht es aber auch nicht. Vielmehr bedarf es eines Zusammenschlusses von Architekten, Landschaftsarchitekten, Raumplanern, aber auch Juristen und Ökonomen, privaten Bauwilligen und der breiten Öffentlichkeit. Raumplanung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur durch einen gemeinschaftlichen Diskurs, den wir als Baukultur bezeichnen können, lässt sich die Siedlungspolitik wieder in geordnete Bahnen lenken.[7]
Die vorliegende Arbeit unternimmt eine Analyse und wagt den Versuch eines Lösungsvorschlags. Dem Autor ist durchaus bewusst, dass die aufgezeigte Lösung erst einmal ein Versuch bleibt. Sie soll als Grundlage für eine Diskussion verstanden werden und die Probleme rund um die Baugesetzgebung wieder im Diskurs der Architekten verankern. Die Arbeit versteht sich somit als ein weiterer «Aufruf zur Tat», wie er seit Jahrzehnten immer wieder erklang und genauso oft ungehört blieb.[8]
[1] Max Frisch: «Der Laie und die Architektur. Ein Funkgespräch», in: ders.: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge, 1949-1956, Frankfurt a.M. 1976, S. 263.
[2] Othmar Birkner: Bauen und Wohnen in der Schweiz 1850-1920, Zürich 1975, S. 43.
[3] Generell zum Thema: ARCH+ Nr. 225: Legislating Architecture; Arno Brandlhuber, Christopher Roth und Antonia Steger (Hg.): Legislating Architecture Schweiz, Zürich 2016; Alex Lehnerer: Grand Urban Rules, Rotterdam 2009; Oliver Streiff: Baukultur als regulative Idee einer juristischen Prägung des architektonischen Raums, Baden-Baden 2013.
[4] Art. 75 Abs. 1 Bundesverfassung.
[5]Siehe die Illustration zu § 3 in der Allgemeinen Bauverordnung des Kantons Zürich.
[6] Rudolf Muggli: «Nicht-Siedlungsgebiete», in: Alexander Ruch und Alain Griffel (Hg.): Raumplanungsrecht in der Krise. Ursachen, Auswege, Perspektiven, Basel/Genf/Zürich 2008, S. 105.
[7] Oliver Streiff: Baukultur als regulative Idee einer juristischen Prägung des architektonischen Raums, Baden-Baden 2013.
[8] Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter: achtung: die Schweiz. Ein Gespräch über unsere Lage und ein Vorschlag zur Tat, Basel 1955.